Hotz-N-Plotz | K18 | Insel des Lächelns
Wagenplatz
Hotz-N-Plotz
„Bisher dabei: Maler, Raumgestalter,
Filmer, Schauspieler, Musikanten. Was fehlt: Revolutionäre, Idealisten,
Mechaniker" (zit. in: Stattzeitung 5/82:5).
Im Sommer 1981 stellt die GhK der KünstlerInnengruppe '1a Kasseler' ehemalige Fabrik- und Büroräume in der Mombachstraße 1 und 3, zunächst befristet, zur Verfügung. Die Projektgruppe will eine Atelierausstellung für KünstlerInnen aus Kassel und Umgebung realisieren.
Die Gruppe nutzt zudem die angrenzende Freifläche Mombachstraße 5. 1982 steht der erste Wohnwagen eines Mitglieds der KünstlerInnengruppe auf dem asphaltierten Teil der Freifläche. 1984 wohnen auf dem Platz zwei Erwachsene und ein Kind in zwei Bauwagen, später genehmigt die Hochschule der Initiative 'Mobiles Informations- und Kommunikationsforum e.V.' das Abstellen eines Bauwagens auf dem Gelände. Zwischenzeitlich machen die BewohnerInnen einen Mauerdurchbruch zu den Büroräumen in der Mombachstraße 3, um die sanitären Anlagen mitnutzen zu können. Eine Grünfläche im hinteren Teil wird für Ausstellungen und von vielen Menschen, vor allem StudentInnen, im Sommer als Treffpunkt genutzt. 1994 wohnen auf dem Platz vier Menschen, 1995 kommt ein weiterer Wagen hinzu. Den BewohnerInnen, überwiegend StudentInnen, ist es wichtig, die Grünfläche öffentlich zugänglich zu lassen, dort keine Wagen zuzustellen.
1996 will die Hochschule das Gelände verkaufen. Zunächst kommt die Stadt als Käuferin in Betracht. Ein weiterer Interessent ist Professor Thelen von der GhK. Er will auf der Freifläche Wohnungen nach einem Siedlungsgenossenschaftsmodell bauen. Ernstzunehmendster Interessent aber ist die 'Sozialer Impuls GmbH'. Die u.a. aus Mitgliedern von Bündnis 90/DIE GRÜNEN bestehende GmbH will Wohnungen und eine Kindertagesstätte bauen, die von Kindern Hochschulangehöriger besucht werden soll. Die Hochschule kündigt an, daß im Herbst 1996 Baubeginn sei, im Herbst setzt sie ihn auf das Frühjahr 1997 fest. Die BewohnerInnen werden weder an der Planung beteiligt noch miteinbezogen. Der Kanzler der GhK, Gädeke, bezeichnet sie als „für die Planung nicht existent".
Aus Protest gegen die bevorstehende Bebauung beteiligt sich der Wagenplatz im Oktober 1996 zusammen mit den anderen Wagenplätzen und dem Projekt Messinghof an der Demonstration 'Statt Verwaltung - Selbstverwalten'. Daneben macht der Platz mit öffentlichen Aktionen vor der Hochschule und einem offenen Brief an die GhK auf die Problematik aufmerksam.
Im Dezember 1996 finden Gespräche
mit der Bauabteilung der GhK statt. Plötzlich zeigt sich die Hochschule
transparent und klärt die BewohnerInnen über die Bebauungspläne
auf. Die BewohnerInnen fordern, auf dem Gelände zu verbleiben. Sie
betrachten sich als Teil einer Basisbewegung, die mit anderen Wohnformen
experimentiert, und erklären sich bereit, an einer Lösung des
Konflikts mitzuarbeiten.
Wagenplatz
K18
Nördlich der Gesamthochschule befindet
sich eine etwa 3.000 qm große Freifläche, die durch die Ahna,
die Moritzstraße, die ehemalige Henschelhalle K18 und die Firma Doerr
und Pfeiffer begrenzt ist. Das Gelände gehört der GhK. Durch
die Erweiterung der Gesamthochschule am Holländischen Platz muß
die GhK Ausgleichsflächen schaffen, sie will auf dem Gelände
langfristig den 'Nordstadtpark' ähnlich der Goetheanlage realisieren.
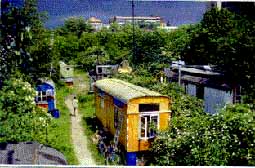 „[…]
um die Anonymität und Menschenfeindlichkeit der Städte zu durchbrechen.
[…] Der Wagen wird zur Bühne für die Außenstehenden und
sie werden gleichzeitig die DarstellerInnen des Stückes, das für
die WagenbewohnerInnen aufgeführt wird. [...] Wir zerstören damit
die Mär von der Notwendigkeit des Gartenzaunes"
„[…]
um die Anonymität und Menschenfeindlichkeit der Städte zu durchbrechen.
[…] Der Wagen wird zur Bühne für die Außenstehenden und
sie werden gleichzeitig die DarstellerInnen des Stückes, das für
die WagenbewohnerInnen aufgeführt wird. [...] Wir zerstören damit
die Mär von der Notwendigkeit des Gartenzaunes"
(Wagenplatz K18 1989).
Im Herbst 1988 gründen StudentInnen am Fachbereich Sozialwesen mit dem Betreuer Fritz Spitzer das Projekt 'Schrottkunst/ (Über-)Leben im Herzen der toten Stadt'. Die GhK stellt für den Ausbau von drei Bauwagen im Wintersemester 88/89 die Halle K18 zur Verfügung. Das Projekt hat zum Ziel, mit Bauwagen im städtischen Raum zu wohnen. Am 1. Januar 1989 ziehen die ProjektlerInnen die fertigen Wagen auf die Freifläche neben der Halle K18. Im Sommersemester 1989 melden die BewohnerInnen, inzwischen auf sechs StudentInnen der Fachbereiche Sozialwesen, Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung angewachsen, das interdisziplinäre Projekt 'Leben in der Substruktur' an. Das nur im 'Erfahren' zum Ziel führende Projekt hat nun nicht mehr zum Ziel, die Wagen im städtischen Raum aufzustellen, sondern will zumindest vorerst auf dem Gelände der K18 verbleiben. Das 'Leben in temporären Strukturen', das flexibel ist und keine Spuren hinterläßt, sehen die BewohnerInnen als Alternative zu Stein, Holz und Stahl. Das Leben in selbstausgebauten Wagen ermöglicht eine selbstbestimmte, nicht durchgeplante, von Eigentum und Politik unabhängige Aneignung städtischer Räume. Das Projekt will Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre überwinden.
„In den Jahren, die wir auf dem Platz wohnen,
haben wir uns zu einer großen Gruppe entwickelt, die zwar die Alltagsorganisation
(Kochen, einkaufen...) sowohl einzeln, als auch in zwei Küchenwagen,
Entscheidungen aber, die die ganze Gruppe bzw. den Platz betreffen, gemeinsam
bespricht und regelt. Wir haben z.B. die Anzahl der BewohnerInnen auf 15
Personen beschränkt, um die Gruppe überschaubar zu halten […]"
(AStA-Zeitung Nr. 12 zit. in: Siemon 1991:15).
Die BewohnerInnen gestalten den Platz,
pflanzen Kräuter, legen Wege an und bauen einen Hühnerstall.
Sie organisieren den Alltag zusammen.
1990 beendet Spitzer das Projekt. Die
Hochschulverwaltung fordert die BewohnerInnen auf, den Platz zu verlassen.
Die BewohnerInnen bleiben. In einem Gespräch mit dem AStA sichert
der Präsident zu, daß die Wagen bis zum weiteren Hochschulausbau
auf dem Gelände verbleiben können. Im Mai 1991 werden an drei
der Wagen Aufforderungen zur Räumung geheftet, bei Nichtbeachtung
erfolge eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Im Juni versucht die GhK-Verwaltung
massiv, Namen der Projekt-Mitglieder in Erfahrung zu bringen. Alle Versuche
der BewohnerInnen, den Anschluß an Strom, Wasser und Müllentsorgung
über eine Pacht zu regeln werden von der Hochschule ignoriert. Im
Mai 1991 organisieren die BewohnerInnen einen Tag der offenen Tür
mit Kaffee, Kuchen, Fotos und Erzählungen. Auf dem Flugblatt zur Einladung
weisen sie darauf hin, daß mittlerweile 15 Wagen auf dem Gelände
stehen. Im Dezember veranstalten sie das 'Fest des Wagenplatzes' im Autonomen
Zentrum mit Informationen und Live-Musik. 1992 finden in Kassel die 'Wagentage'
statt, ein internationales Treffen mit etwa 70 Menschen, die auf Rädern
leben. 1992 formulieren die BewohnerInnen ihr Selbstverständnis in
der Zeitung der Fachschaft 12/13. Sie stellen heraus, daß der zunehmende
Mangel an bezahlbarem Wohnraum auch einen Mangel an lebenswertem Wohnraum
nach sich zieht.

Die Strategie der GhK ändert sich
1992, sie startet eine Offensive: Der Platz soll einer Liegewiese weichen,
die als Übergangsnutzung bis zum weiteren Ausbau entstehen soll. Langfristig
soll das Gelände endlich als Ausgleichsfläche im Rahmen des Nordstadtparks
umgestaltet werden, wie Klaus Sausmikat von der Hochschulbauabteilung erklärt.
Sausmikat spricht ebenfalls davon, der Halle K18 eine Kindertagesstätte
anzubauen. Gegen deren Bau spricht allerdings, daß das Gelände
als Frischluftschneise dient und nicht versiegelt werden darf. Die BewohnerInnen
reagieren mit verstärkter Öffentlichkeitsarbeit für das
Projekt. Mit Infoständen, Flugblättern, Unterschriftenlisten,
Zeitungsartikeln und Fernsehberichten versuchen sie, den Plänen der
Hochschule zu widerstehen. Am 14. März organisieren sie die Demonstration
'Der Frühling kommt - wir bleiben'. Die Grünen und die Bunte
Liste beziehen als politische VertreterInnen positiv Stellung. Am 24. März
findet ein Gespräch mit Vertretern der Hochschulverwalltung und dem
Präsidenten statt, die eine gemeinsame Planung mit den BewohnerInnen
zum Thema hat. Die Runde verläuft ergebnislos. Die Hochschule setzt
ein Ultimatum: Bis zum 15. April, dem Beginn des Sommersemesters, sollen
die BewohnerInnen samt Wagen verschwinden. Der 15. April verstreicht,ein
neues Ultimatum mit Androhung strafrechtlicher Schritte ebenso.
In der Zwischenzeit diskutieren die BewohnerInnen
mehrmals untereinander über einen Platzwechsel, im Gespräch ist
auch der Ankauf oder die Pacht einer Fläche. In Betracht kommen z.B.
das Gelände um die Hindenburg-Kaserne, für das sich die Kasernen-Initiative
interessiert, und ein Gelände am Rammelsberg. Als Übergangslösung
für den Fall einer Räumung fragen sie bei dem 1991 entstandenen
Wagenplatz in der Mombachstraße an.
1996 versucht es die Hochschule erneut.
Auf dem Gelände soll im April 1997 mit Arbeiten im Rahmen der Freiflächenplanung
begonnen werden, die Gelder für Planung und Ausführung seien
bewilligt. In einem Gespräch mit dem AStA signalisiert Präsident
Brinckmann allerdings, daß über ein Konzept zur Legalisierung
des Platzes diskutiert werden könne. Über den AStA reicht der
Wagenplatz nun einen Diskussionsvorschlag ein, der ein Pachtverhältnis
anstrebt. In einer Gesprächsrunde mit AStA, StuPa und BewohnerInnen
im Dezember machen Sausmikat und Schröder von der Bauabteilung klar,
daß der Platz am derzeitigen Standort nicht weiter geduldet und die
GhK sich nicht um Ausgleichsflächen bemühen wird. In folgenden
Gesprächen aber drängen sie förmlich darauf, daß sich
der AStA Hochschulflächen in der Gottschalkstraße zur Verfügung
stellen läßt, die er im Rahmen eines studentischen Projekts
an die BewohnerInnen der Wagen weitervermieten soll (die Freifläche
bietet nicht einmal genug Platz für die Hälfte der BewohnerInnen,
geschweige denn für die Wagen des ebenfalls bedrohten Hotz-N-Plotz).
Die GhK schanzt damit dem AStA die Verantwortung zu, den dort entstehenden
Wagenplatz im Falle einer schnellen Kündigung durch die Hochschule
zu räumen.

Nur wenige Wochen später zieht die
Hochschule das Angebot der Fläche zurück, da diese saniert werden
sollle und ohnehin bald bebaut würde. Im September 1997 veröffentlicht
das Staatsbauamt die Ausschreibung für die Baumaßnahmen auf
K 18, die bereits im Oktober beginnen sollen. Mehrere selbstverwaltete
Gruppen und Initiativen protestieren schriftlich beim GhK-Präsidium
und fordern den Erhalt der Wagenplätze.
Wagenplatz Insel
des Lächelns
Das unbebaute Gelände zwischen Mombachstraße
und Fiedlerstraße gehört der Stadt Kassel. Den hinteren Teil,
über den ehemals die Fiedlerstraße führte, nutzt eine Baufirma
als Lagerplatz.
„Da wir nach Beobachtung durch mehrere
Mitarbeiter die dringende Vermutung haben, daß Sie in dem Bauwagen
wohnen, der im übrigen Schrottreife besitzt, teilen wir ihnen mit,
daß die Stadt Kassel das nicht zulassen kann. Das unbebaute Grundstück
ist zum Bewohnen ungeeignet"
(Schreiben des Liegenschaftsamtes vom
20.6.1991).
Im April 1991 siedelt auf dem Platz eine
Person mit ihrem Bauwagen und einem Traktor. Das Liegenschaftsamt der Stadt
Kassel reagiert mit einem Schreiben, das es an die mittlerweile zwei Wagen
heftet. Die Stadt empört sich über das Abstellen eines Wagens,
ohne die Eigentümerin um vorherige Erlaubnis gefragt zu haben.
Den Bewohnern wird ein Ultimatum gestellt,
den Platz zu verlassen, anderenfalls drohe eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs,
unerlaubter Abfallbeseitigung und Verstoßes gegen die Zeltplatzverordnung
der Stadt. Entstehende Kosten würden durch die Verwertung des Traktors
ausgeglichen. Die Stadt sei nicht gewillt, Selbsthilfe Wohnungsloser zu
akzeptieren, wer auf der Straße sitzt hat „selber Schuld" (zu dieser
Zeit sind in Kassel 6.000 Menschen auf Wohnungssuche und 1.000 obdachlos).
Die Bauwagenbewohner und UnterstützerInnen reagieren mit einem Solidaritätszelten
für 'selbstbestimmten Lebensraum' am 27. Juni.
In einem Schreiben des Liegenschaftsamtes
vom 9. September 1991 werden die Bewohner erneut aufgefordert, den Platz
zu räumen. Dem Brief liegt ein Artikel des Extra-Tip bei, der auf
eine Beratungsstelle für Wohnungslose hinweist.
Der Druck der Stadt läßt nach,
der Platz wächst in der Folgezeit auf über zehn Menschen, die
in Wagen und LKWs leben. Der Zuzug erfolgt anfangs eher ungeregelt, d.h.,
anders als auf K18 dominieren nicht Studierende, auf den Platz zieht wer
will. Regelmäßige Plena und das Konsensprinzip halten erst später
Einzug. 1996 schafft sich der Platz erstmals einen gemeinsamen Küchenwagen
an.
Am 16. März 1995 macht Oberbürgermeister Lewandowski einen Rundgang durch die Nordstadt. Unangemeldet will er dabei auch den Wagenplatz begutachten. Die BewohnerInnen haben im Vorfeld davon erfahren und bereiten einen 'Tag der offenen Türen' mit Café und Kuchen vor. Nachdem er sich erklären läßt aus welchen Gründen Menschen in Wagen leben, liest Lewandowski aus einem Brief vor, den er von Bürgermeister Gehb erhalten hat. Der sei zu dem Ergebnis gekommen, den Wagenplatz zunächst zu dulden.
Am 6. April 1995 befaßt sich der Ortsbeirat mit dem Wagenplatz. Für die BewohnerInnen der Nordstadt sei er ein „Schandfleck" meint Ortsvorsteher Zimmer. Bemängelt werden beispielsweise fehlende sanitäre Anlagen und zuviel Müll auf dem Gelände. Haarklein müssen die BewohnerInnen die Verrichtung ihrer Notdurft schildern. Dabei wollen Mitglieder des Ortsbeirats wissen, wieviel Minuten es zur nächsten Kneipe oder zur WG von FreundInnen sei. Die BewohnerInnen versprechen, sich einen Toilettenwagen anzuschaffen und für eine geordnete Müllentsorgung zu sorgen. Der Ortsbeirat kündigt soziale Kontrolle an; da seine Mitglieder ohnehin öfter dort vorbeiführen, würden sie die Entwicklung beobachten und gegebenenfalls erneut beraten.
Weil der Platz von der Stadt geduldet wird,
machen die BewohnerInnen wenig Öffentlichkeitsarbeit. Im Oktober 1996
organisiert der Wagenplatz zusammen den anderen Plätzen und dem Messinghof-Projekt
die bunte Wagen-Demonstration 'Statt Verwaltung - Selbstverwalten!'.